
Wohnlandschaften
No. 33 | 2019/1«Obacht Kultur» No. 33, 2019/1 zum Thema Wohnen.
Auftritt: Thomas Stüssi. Bildbeiträge: Florian Graf, Walter Angehrn. Texte: Julia Weber, Ingrid Feigl, Christian Rothmaler u.v.m.
Ausgabe bestellen
Thema
Wohnbefinden




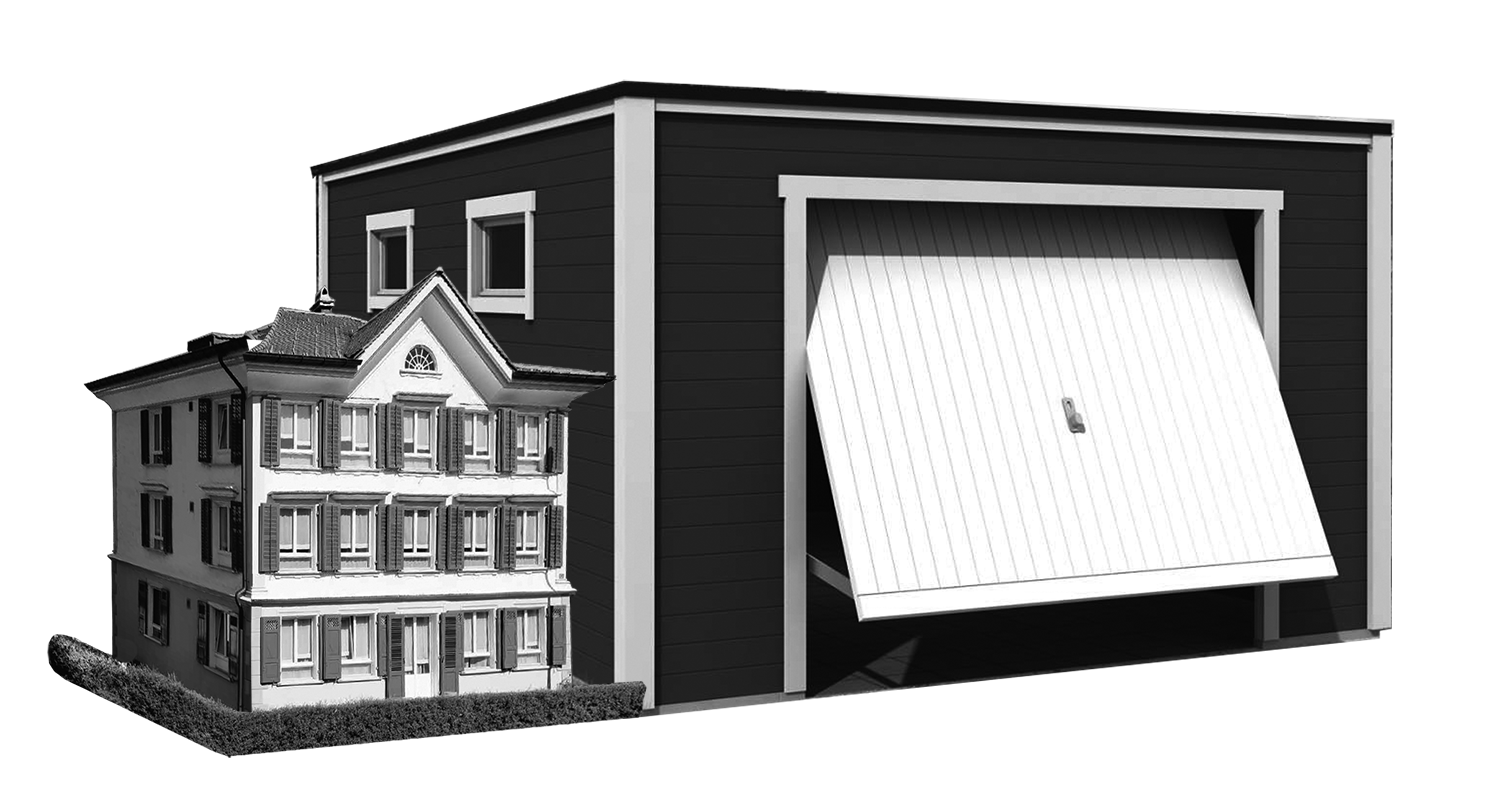

Alle tun wir es: Wohnen. Mal besser, mal schlechter, mal lauter, mal leiser, mal glücklicher, mal einsamer, mal aufgeräumt, mal chaotisch. Ob im denkmalgeschützten Appenzellerhaus, im Block aus den Sechzigerjahren oder in der Villa mit Seeblick, ob in vielen Zimmern, auf engem Raum oder auf der Strasse: Alle wohnen irgendwo und irgendwie. Beim Wohnen geht es um Eigentum und Nachbarschaft, um Ortsplanung und Privatsphäre, um Grundbedürfnisse und den persönlichen Stil. Vom Wohnen leben Immobilienbranche und Banken, schwedische Einrichtungshäuser und lokales Handwerk. Wohnen ist einerseits ein gewaltiges Geschäft und andererseits eine alltägliche, soziale Handlung. Und nicht zuletzt Ausdruck individueller seelischer Befindlichkeiten.
Was also passiert, wenn mehrere Leute ihre persönlichen Assoziationen, Erfahrungen oder Überlegungen zum Stichwort «Wohnen im Appenzellerland» in Worte fassen? Es entsteht zuerst einmal eine schöne Unordnung. Diese unterschiedlichsten Textelemente zu einem Ganzen zusammenzustellen war denn auch, wie eine Wohnung einzurichten: Da gibt es die sperrigen Teile, die praktischen, die hübschen und die überflüssigen, an denen man trotzdem hängt. Für jedes braucht es einen Platz, an dem es funktioniert oder gut zur Geltung kommt. Und das Ganze muss im besten Falle ein harmonisches Ensemble ergeben oder zumindest einen lesenswerten Ort ohne zu viele Stolpersteine. Sönd willkomm.
Volkslied
«En Appezölle Hüüsli het Frohsinn und Verstand», heisst es im einfachen Volkslied. In diesen unbedarften und schlichten Worten klingt ein Selbstverständnis an, das auf Uraltgewohntes verweist, das keiner Reflexion bedarf. Es ist wie die einfachste Formel eines Baukonzeptes: gebündelte Ansprüche an Funktion, Ästhetik und Stimmung. Als Guido Koller in Gais ein verlassenes und verwahrlostes Bauernhaus ins Auge fasste und darin ein abgenutztes und mitgenommenes Schmuckstück erkannte, erinnerte er sich wohl kaum dieses Liedanfangs. «… ond luegt mit hölle Schiibe i d Sonn ond wiit is Land ...». Er sah den einzigartigen Platz, der die alte Volksregel der Streusiedlung von angemessener Ferne und doch nachbarlicher Sichtweite erfüllt. Das alte Haus hatte offensichtlich ausgedient. Ein Traum blitzte auf und liess ihn nicht mehr los. Guido Koller gab einer ungeahnten Sehnsucht nach. Ein Haus zum Sein, ein Haus für die Kunst, eine Persönlichkeitsherausforderung? Fragen und Gedanken, Überzeugung und Zweifel. Sich leiten lassen von Wünschen und Wege entwickeln, die überzeugen und sich konkretisieren lassen. Genüsslich und experimentierfreudig ging er das Projekt an und erarbeitete mit Rahel Lämmler eine architektonische Struktur, die sich weder aufspielt noch anbiedert, aber weiträumig Spielraum für individuelle Ideen schuf. Für die Innengestaltung setzte sich der Bauherr persönlich mit ausgewählten Handwerkern und Fachleuten zusammen und entwickelte die innere Gliederung – aus eigener Gestaltungskraft und mit ungeahnter Gestaltungslust. Die unmittelbare Zusammenarbeit, die Leidenschaft für Materialien und Verarbeitung führte zu qualitativen Höchstleistungen. Es war ein Prozess mit Sorgfalt und ohne Zeitdruck. So wurde aus dem Abenteuer eine spielerische, wandelbare Wohnbühne mit Konstanten, ein Haus mit Frohsinn und Verstand. (an)
PANORAMA
Lange dachte ich: entweder, oder. Entweder man hat Sicht auf den Säntis, auf die dräuende Kraft des Ostschweizer Himalayas. Oder man blickt hinaus in die unendlich scheinenden Weiten des Sees, in eine Landschaft voller Liebreiz und Verheissung. Aber es gibt wirklich einige Hügel und Kreten – oh glückliche Bewohner und Bewohnerinnen von Rehetobel, Teufen, Bühler –, von wo aus man beides zugleich sieht. (ic)
«KEIN BALKON! KEIN LIFT! UND, UND, UND ...»
Bei der Durchsicht des Mietwohnungsmarktes in Appenzell Ausserrhoden finden sich wie überall Sprachperlen, seltsame Prioritäten und schönmalerische Aussagen. Routinierte Leser und Leserinnen von Wohnungsinseraten wissen, dass Angaben wie «zentral gelegen» auch im ländlichen Raum vor allem Lärm und «Appenzellerhaus» längerfristig einen gebückten Gang bedeuten. Die vielen Altbauten – der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat schweizweit am meisten – entsprechen oft nicht mehr den heutigen Wohnstandards. Aus Not streicht man bei der Mietersuche deshalb jeweils das Urtümliche hervor und setzt auf Charme, dass sich die Balken biegen. In einem Inserat auf der Internetplattform Immoscout24 war beispielsweise eine «herzhafte 2.5 Zi-Wohnung im urchigen und historischen Herisau» ausgeschrieben. Die Zürcher Immobilienfirma fügte beschwörend hinzu, dass «im Appenzell, so sagt man sich, Traditionen täglich gelebt und geschätzt» würden. Allerdings will man in den Inseraten auch nicht ganz ausschliessen, dass diese Region an ausgewählten Stellen doch im Heute angekommen ist und Überraschendes zu bieten hat. Das klingt dann folgendermassen: «Die rustikale Arbeitsplatte sorgt noch für ein modernes Flair.» Oder zumindest für Herisauer eigentlich wenig überraschend: «Ein Einkaufscenter befindet sich im Haus.» (ic)
MAMIDOWÖTTIWOHNE
Die Werbetafel an der Strasse hat mich jedes Mal angesprungen. Dabei bezeichne ich mich als recht resistent gegenüber jeglichen Bemühungen dieser Art, seien es Waschmittel-, Versicherungs- oder Kaffeemaschinenreklamen. Doch diese musste ich bei jeder Fahrt von Speicher nach Trogen anschauen und lesen, und wie ein Ohrwurm hat sie mich danach für Stunden verfolgt und mit einer Portion Aggressivität versorgt: Mamidowöttiwohne, Mamidowöttiwohne, Mamidowöttiwohne. Zu sehen war sehr lange nichts an dieser Stelle, abgesehen von der verheissenden Werbung mit dem lachenden Kind, dem Mamidowöttiwohne in den Mund gelegt wurde als Wunsch an die Mutter. Die geplante und unterdessen längst gebaute und gut bewohnte Siedlung liegt am der Strasse abgekehrten Hang, der schönen Aussicht auf einen Schnitz See zugewandt. Zufälligerweise kenne ich ein paar, die dort wohnen. Vom verdichteten Wohnen waren und sind sie aus eigenen Stücken überzeugt. Kinder haben sie jedenfalls keine. (ubs)
EINBLICK
Im Appenzeller Magazin erscheint jeweils eine Rubrik, in welcher Menschen sich in ihren umgebauten vier Wänden zeigen. Warum tun sie das? Bei drei Personen, die vorgestellt wurden, habe ich nachgefragt: Bei der einen war die Freude über das eigene Hüsli, und diese mit anderen zu teilen, ausschlaggebend. Bei der anderen die Gelegenheit, den vielen Fragen, warum denn das alte Haus einem neuen weichen musste, gleich öffentlich zu begegnen. Im dritten Fall hat die Überlegung mitgespielt, dass man mit einem Einblick in die gelungene sanfte Renovation eines alten Appenzellerhauses anderen ein Beispiel geben kann, wie sich Altes mit Neuem stimmig und funktional verbinden lässt. Kein frommer Wunsch, wie sich gezeigt hat: Ein Paar hat nach einer Besichtigung vor Ort sein eigenes Haus – wie die Ideengeberin meint – noch schöner umgebaut als ihr eigenes. Über den Artikel und die Bilder freuen sich auch die am Umbau beteiligten Handwerker; sie erleben den Bericht als grosse Wertschätzung. Alle drei Befragten erzählen, dass sie zahlreiche Mails, Telefone, Briefe und persönliche Reaktionen bekommen haben. Von Bekannten, aus der Verwandtschaft, dem beruflichen Umfeld, aber ebenso von fremden Leuten. Sogar mit Ausgewanderten und Heimwehappenzellern in Frankreich und Deutschland führten sie längere Korrespondenzen, und Jahre später werden sie noch auf den Artikel angesprochen. All diese neuen und wieder aufgelebten Kontakte und die ausschliesslich positiven Reaktionen haben die Porträtierten sehr gefreut – sie würden alle ihre Türen wieder öffnen. Heute gehören sie selbst zu den regelmässigen Leserinnen und Lesern der Kolumne und freuen sich über die Möglichkeit, anderen in die Stube zu blicken. (bü)
SICHTSCHUTZ
Wohnen geschieht gerne im Verborgenen. Und weil mehr und mehr auch im Garten gewohnt wird, will man auch diesen vor neugierigen Blicken schützen. Dazu bedient man sich gerne und oft der Thuja, auch Lebensbaum genannt. Thujahecken schaffen aber keine Lebensräume, weder für Vögel noch für Igel noch für Insekten. Von Naturfreunden werden sie deshalb angefeindet: «Thujen sind das Grauen!» Besser sei es, ordentliche Hecken mit einheimischen Sträuchern zu pflanzen. Thujabäume verändern und prägen in Heckenform die Landschaft mehr, als jedes andere Gewächs, mehr sogar als die Einfamilienhäuser selbst. Sie zeigen, was uns wichtig ist: Privatsphäre, Abgrenzung, Sichtschutz. (sri)
ALLES AM TISCH
Erst die Hausaufgaben, dann das Gemüse rüsten, nachher Nachtessen. Anschliessend vielleicht die Steuererklärung oder doch lieber ein Spiel? Ein Tisch kann vieles sein: Familienzentrale, Pult, Büro, Ess-, Arbeits- und Ablagefläche. «Je grösser ein Tisch, desto mehr dient er nicht nur dem Essen», sagt Ueli Frischknecht. Der Schreiner aus Trogen hat ein Serienmodell entworfen: Taktak. Er ist 240 Zentimeter lang: «Oft wünschen die Käuferinnen und Käufer eine kürzere Version, aber danach bereuen sie es. Sind sie erst einmal an den Tisch gewohnt, hätten sie gern, wenn er mehr Platz böte.» Auch die Tiefe des Tisches folgt nicht irgendeinem Zufallsmass: «Die Frage ist, wie will man sich begegnen? Mit Taktak wollten wir die alten Biergartengarnituren ersetzen.» Also weniger tafeln, dafür dem Gegenüber näher sein.
Aussergewöhnlich viel Platz bietet auch der Tisch im Palais Bleu, der Genossenschaft im alten Spital in Trogen: «14 Personen können locker daran essen», so Mitgenossenschafterin Karin Karinna Bühler. In der Spitalküche hat der Tisch seine Bestimmung gefunden. Dabei war das keineswegs der erste Aufstellungsort: Ursprünglich wurde er für eine Ausstellung im Zeughaus Teufen gebaut. Danach verwendete ihn Karin Karinna Bühler als Arbeitstisch im Atelier: «Aber dort war er nicht handlich. Er war zu gross für den Raum, also brachten wir ihn ins Säli und danach in die Spitalküche. Dort steht er wie massgeschneidert. Besonders schön und praktisch ist es, neben dem Herd zu essen» – Tischkultur mit kurzen Wegen und guten Gesprächen. (ks)
KOCHINSELBLUES
Die Fenster reichen vom Boden zur Decke. Zu sehen ist der Alpstein, von der untergehenden Sonne beschienen. Wohn- und Kochbereich gehen ineinander über. Eichenparkett, dezente Anthrazittöne, die Kochinsel mit integriertem Dampfabzug. Auch wenn etwas anbrennt, ist nichts zu riechen. Leise Klaviermusik. Die Flächen blank. Die Wohnung aufgeräumt. Das Design kommt zur Geltung. Keine Zeitungen, keine Kochbücher, keine Einkaufstaschen. Nichts. (sri)
VON UNORDNUNG UND GLÜCK
Die Weisheit geht mir nicht mehr aus dem Kopf, ich will sie auch gar nicht mehr hergeben. «Lot of rubbish around, very happy family.» Gehört habe ich sie vor vielen Jahren von einem afrikanischen Anthropologen bei einem Einführungskurs in die Kultur der Shona in Simbabwe. Oder war es die Nachbarin, die sie mich lehrte, in Form eines blossen Kommentars zum verstreut im Freien herumliegenden Hausrat, bestehend aus Kochkelle und Büchsen, Gummistiefel, zerfledderter Zeitung, Stofffetzen, Schemel gekippt, Veloschlauch oder so ähnlich? Mich rettet sie jedenfalls bis heute davor, durch Ordnungseifer drangsaliert zu werden. Und sie bleibt auch hierzulande ein Kriterium zur atmosphärischen Einschätzung von Wohnsituationen: Wie viel Wert wird auf die Aussenwahrnehmung gelegt, wie gross ist der Zwang zur Repräsentation, stimuliert Gelassenheit den Austausch? (ubs)
ZINN IM ESTRICH
«Der Markt ist tot», knurrt der Antiquar ins Telefon. Antike Kannen, Teller, Schüsseln aus Zinn waren vor einigen Jahrzehnten gesucht, selten, teuer. Die Expertenmeinung von Carl Rusch (1918–2004) war gefragt. Der Innerrhoder Jurist, der sich leidenschaftlich mit Kunstgeschichte und Volkskunde befasste, kannte sich aus mit den appenzellischen Zinngiessern des 18. und 19. Jahrhunderts. Wer auf seinen freundschaftlichen Rat hörte, kaufte für die eigene Wohnung die besten und kostbarsten Stücke.
Die Erben wissen nicht mehr, was damit anfangen. Was einst tausend Franken oder mehr kostete, wird im Internet für zwanzig oder dreissig Franken angeboten. Ein Symptom dafür, wie die unnützen Sachen, mit denen Wohnungen ausgestattet werden, der Mode unterworfen sind: Was für die eine Generation Ausdruck höchster Kultiviertheit war, wird von der anderen als Gerümpel auf den Estrich verbannt. Die Enkel stossen dann vielleicht irgendwann darauf und sind entzückt. Und der Kreislauf beginnt von neuem. (sri)
GRILLBALKON – BALKONGRILL
Der Balkon ist klein, aber sehr prominent. Wohl diente er einst als ideale Beobachtungsplattform, wie die Erker der Bürgerhäuser dies taten. Nicht in erster Linie um den Säntis anzubeten. Der Blick reicht weit ins Säge-Quartier, dorthin, wo damals die Arbeiterfamilien wohnten. Wer trödelte auf dem Kirchgang, wer in die Badi statt in die Schule ging, wer bei der Abzweigung mit der neuen Liebschaft schmuste – alles konnte vom Balkon des Kirchgemeindehauses aus gesehen werden. So stelle ich es mir zumindest vor. Heute aber haust auf dem Balkon ein Grill; eines jener üppigen Modelle, gasbetrieben, mit ausladender Tischplatte fürs Mise en Place und differenzierter Grillbesteck-Halterung. Das neue Freiluft-Herzstück jeden Haushalts, das den Kachelofen auch im Zuge der klimatischen Verschiebungen verdrängt, macht sich so breit, dass kein Raum bleibt für das Beobachten des Geschehens auf der Strasse. Ganz allgemein scheint die allerorts nach aussen gekehrte Grillgemütlichkeit Beweis für viele unbeschwerte Momente mit Freunden zu sein. Oder zumindest für die Sehnsucht danach. Das Interesse an der Befindlichkeit der Nachbarin könnte dabei auf der Strecke bleiben. Für verbleibende Kontrollbedürfnisse sind Überwachungskameras praktischer. (ubs)
Texte beigetragen haben Margrit Bürer, Ursula Badrutt, Isabelle Chappuis, Agathe Nisple, Kristin Schmidt und Hanspeter Spörri.
